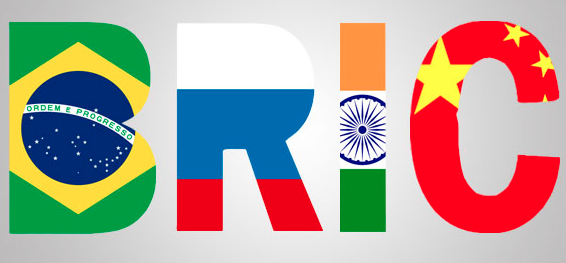Die vier kleinen Flaggen auf Jim O’Neills Schreibtisch stehen für eine große Idee. Vier Nationen, die einander jahrzehntelang zumeist ignoriert, angefeindet, teils sogar bekriegt haben, tun sich zusammen, ihre Herrscher treffen sich zu Vierergipfeln und schmieden Koalitionen gegen das Establishment im Westen. Und er, Jim O’Neill, der britische Investmentbanker, hat sie vereint, stark gemacht. Mit einem simplen, eingängigen Label:
B-R-I-C - aus den Anfangsbuchstaben von Brasilien, Russland, Indien, China.
Zehn Jahre ist es her, da erfand der damalige Chefvolkswirt von Goldman Sachs am Schreibtisch den Begriff, der die Weltwirtschaft und ihre Kapitalgeber seither verzaubert wie kein zweiter. Bric steht für Aufbruch in ein neues Zeitalter, für eine Verschiebung der ökonomischen und politischen Kräfteverhältnisse, weg von Nordamerika und Westeuropa. Für riesige, aufstrebende Märkte, für Investments mit Traumrendite. Und vor allem: für scheinbar grenzenlosen, immerwährenden Aufschwung.
Fast die Hälfte des globalen Wachstums der vergangenen Dekade entstammte den vier Bric-Staaten. Nicht eingerechnet all die glänzenden Geschäfte, die deutsche Maschinenbauer, US-Konsumgüterhersteller oder französische Luxuskonzerne mit der konsumhungrigen Neukundschaft aus Süd und Ost machten. Das Wirtschaftswunder der Brics hat der Welt über die Finanzkrise hinweggeholfen. Abermilliarden haben Geldanleger in die Dutzenden von Bric-Fonds gepumpt - die von Goldman Sachs und allen möglichen anderen Großbanken aufgelegt wurden.
Kann dieses Wachstumsmärchen ewig anhalten? Derzeit erlahmt die Dynamik in den vier Boomstaaten jedenfalls spürbar; die Zeit der selbstverständlich zweistelligen Zuwachsraten ist vorbei.
Brasilien legte zuletzt noch 2,7 Prozent zu, Russland kämpft um die Vier-Prozent- Marke, Indien liegt noch um sechs Prozent im Plus, und selbst in China stottert die Konjunktur. Premier Wen Jiabao persönlich hat die Prognose für 2012 unter die magische Marke von acht Prozent Wachstum gesenkt, die nötig sind, um den Arbeitsmarkt im Gleichgewicht zu halten.
Zugleich treten in allen vier Staaten auf einmal landesspezifische Probleme zutage, die vom Hype überdeckt wurden: mal die überbewertete Währung, mal Inflation, mal explodierende Lohnkosten, eine Immobilienblase, ausufernde Bürokratie oder Korruption.
Auch in der Finanzwelt wachsen die Zweifel am ewigen Bric-Frühling. Die Deutsche Bank warnt vor „strukturellen Schwächen der Bric-Ökonomien“ und ihrer Bankensysteme. Morgan Stanley prangert notorische Reformstaus an. Und selbst bei den Bric-Erfindern lässt die Euphorie nach. „Wir haben wahrscheinlich den Gipfel im potenziellen Wachstum der Brics als Gruppe gesehen“, sagt Dominic Wilson, Jim O’Neills Nachfolger als oberster Bric-Stratege bei Goldman Sachs: „Wir stehen vor einem Übergang zurück zur Normalität. Das Umfeld ist nicht mehr dasselbe wie zwischen 2000 und 2010.“
Die Investoren sind risikoscheuer
Damals waren die Wachstumsbedingungen für Schwellenländer ideal. Erstens generierten die großen Notenbanken mit niedrigen Leitzinsen jede Menge Risikokapital, das nach der geplatzten New- Economy-Blase an den westlichen Aktienmärkten neue Anlagechancen suchte.
Zweitens startete die Globalisierung gerade richtig durch, die Emerging Markets profitierten als preisgünstige Standorte von Produktionsverlagerungen Europas und Nordamerikas. Und drittens hatten Chinas und Indiens Regierungen kurz zuvor mit einschneidenden Reformen die Basis für einen gigantischen Export- und Infrastrukturboom gelegt. Der trieb die Preise an den Rohstoffmärkten hoch - ideal für Brasilien und Russland, die auf enormen Bodenschätzen sitzen.
Dieses Umfeld hat sich inzwischen eingetrübt. Nach der Finanzkrise seien die Investoren viel risikoscheuer geworden, zudem habe sich das weltweite Wachstum verlangsamt, sagt Ruchir Sharma, Chefstratege von Morgan Stanley Investment Management für Schwellenländer.
2011 zogen internationale Kapitalgeber laut dem Spezialdienstleister Emerging Portfolio Fund Research zweistellige Milliarden-Dollar-Beträge aus Bric-Fonds ab. Auch sie wissen: Jeder Boom geht einmal zu Ende.
„Es ist sehr schwierig, wirtschaftlichen Erfolg aufrechtzuerhalten“, sagt Sharma, der für sein neues Buch „Breakout Nations: In Pursuit of the Next Economic Miracles“ die Entwicklung von Schwellenländern untersucht hat. „Die Geschichte zeigt: Nur einer von vier Emerging Markets kann eine durchschnittliche Wachstumsrate von mehr als fünf Prozent zwei Jahrzehnte lang aufrechterhalten.“ Über drei Dekaden hinweg schaffe das nur jeder zehnte Staat - auch weil die Geburtenrate sinke und die Gesellschaft altere.
Ausgerechnet ihre Größe kann den neuen Mächten hinderlich werden. Bestes Beispiel ist China. Der Superstar unter den Brics kam zu Beginn des Wirtschaftswunders Mitte der 90er-Jahre noch weitgehend mit eigenen Bodenschätzen aus.
Heute ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde auf gigantische Rohstoffimporte angewiesen: Bei Kupfer, Blei oder Kohle etwa kauft sie bereits zwischen 30 und 60 Prozent der Weltproduktion auf. Viel Raum nach oben bleibt da nicht mehr.
In China streiten sich die Experten längst nicht mehr darum, ob das Wachstum abflacht. Es geht nur noch um das Wie. Schafft die Regierung ein kontrolliertes Soft Landing - oder droht dem Land ein abrupter, brutaler Abschwung mit sozialen und möglicherweise politischen Verwerfungen? „China ist schon mitten im Hard Landing“, urteilt Adrian Mowat, oberster Emerging-Markets-Stratege von JP Morgan. „Die Autoverkäufe sind am Boden, die Zementproduktion ist am Boden, die Stahlproduktion ist am Boden, die Bauaktien sind am Boden.“ Mowats Beobachtungen könnten auf einen baldigen Kollaps des aufgeblähten Immobiliensektors hindeuten.
Es wäre ein Schock für die Volksrepublik. 45 Prozent der chinesischen Ersparnisse sind eingemauert in Beton. Ob in Peking, Schanghai oder der Provinz: Überall sind neue Apartmentblöcke aus dem Boden geschossen, grau oder pastellfarben. Sie stehen zumeist leer, denn sie dienen allein dem Zweck der Kapitalanlage. In der Hoffnung auf ständig steigende Immobilienpreise werden erst gar keine Mieter gesucht. Niemand weiß, wie groß das Überangebot heute ist.
Der Bauboom sei „der große Treiber des chinesischen Wachstums gewesen“, sagt Nicholas Lardy vom Washingtoner Peterson Institute for International Economics - insbesondere seit 2009, als Pekings Regierung ihr Konjunkturpaket gegen die Finanzkrise verabschiedete und die Staatsbanken Billigkredite von mehr als 400 Mrd. Euro ausschütteten. In nur vier Jahren hat sich die Verschuldung der Haushalte nahezu verdoppelt: auf fast 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Chinas Wachstum sei „nicht nachhaltig“, warnt Michael Pettis, Professor an der Peking University. Die Faktoren, die den Aufschwung 15 Jahre lang befeuerten, seien ausgereizt. Denn auch die Exporte laufen nicht mehr so geschmiert wie früher. Im Februar rutschte Chinas Handelsbilanz erstmals seit 1993 wieder ins Minus. Das Umsteuern hin zu mehr Binnenkonsum als neuem Wachstumstreiber ist politisch extrem schwierig. Pettis traut dem Land für die kommende Dekade nur noch 3,5 Prozent Wachstum pro anno zu. Ein Horrorszenario.
Chinesische Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass für je 0,1 Prozentpunkte unter der Acht-Prozent- Marke bis zu zwei Millionen Jobs verloren gehen. Das hieße 90 Millionen Arbeitslose.
Was getan werden müsste, benennt die Weltbank in ihrem Report „China 2030“: den künstlich niedrig gehaltenen Zins liberalisieren, den Wechselkurs der Landeswährung Renminbi flexibilisieren, die Macht der Staatsbanken und -unternehmen beschneiden. Doch solche Reformen würden den Profiteuren dieser Verzerrungen etwas wegnehmen: Exporteuren, Staatsbanken, Immobilienentwicklern, Lokalregierungen sowie dem allmächtigen Wirtschaftsund Finanzministerium. Viele trauen Chinas von Korruption und Partikularinteressen unterhöhltem Apparat solch einen großen Wurf nicht mehr zu.
Wie die Volksrepublik stecken auch die übrigen drei Bric-Staaten im Reformstau fest. Den Rohstoffriesen Brasilien und Russland gelingt es kaum, sich zu diversifizieren und weitere Exportbranchen aufzubauen; in Indien lähmen überbordende Staatsschulden und Inflation die Wirtschaft. Bürokratie und Korruption wuchern allerorten. „Viele Schwellenländer sind im Erfolg selbstgefällig geworden“, sagt der Inder Sharma. „Sie haben aufgehört, sich zu erneuern.“ Brasilien und Russland sagt Morgan Stanley bis 2020 im Schnitt nur noch rund drei Prozent Wachstum voraus, Indien und China sechs bis sieben Prozent.
Natürlich bleiben alle vier Nationen wichtige Player der Weltwirtschaft. Aber die Wachablösung des Westens fällt vorerst aus. 2012 dürften die USA erstmals seit 2007 wieder mehr zum globalen Wachstum beitragen als China. Neue Dynamik für die Weltkonjunktur erhoffen sich die Experten von anderen Schwellenländern. So erwartet Goldman Sachs, dass der Anteil der Türkei, Indonesiens, Vietnams oder Bangladeschs am globalen Wachstum in diesem Jahrzehnt erheblich wachsen wird. Alle vier Staaten haben mindestens 75 Millionen Einwohner, eine junge Bevölkerung - und gelten als reformfreudig.
Jim O’Neill bleibt seiner Erfindung treu. „Die Brics werden die größte Quelle des globalen Wachstums bleiben“, prophezeit der 55-Jährige. Pessimismus wäre auch geschäftsschädigend: 2010 hat Goldman O’Neill zum Chef der hauseigenen Fondssparte befördert. Und die verkauft Bric-Finanzprodukte.
Brasilien: Die holländische Krankheit
Die jahrelange Aufwertung der heimischen Währung Real legt die Schwächen des Landes bloß: niedrige Produktivität, mangelhafte Infrastruktur und überbordende Bürokratie. Statt die Probleme zu bekämpfen, setzt die Regierung auf Protektionismus.
Tiago Favre weiß, wie man Geld auf der Straße macht: mit billigen Leopardenslips, Stringtangas und Herrensocken. Zu Zehntausenden liegen sie auf den Freiluftmärkten von Rio de Janeiro: die Kreationen von Favres Firma Dominio Corporal sind Wühltischware made in Brazil.
Der Mittdreißiger hat lange gut verdient an Brasiliens Aufschwung, doch jetzt bangt er um sein Geschäft. Denn neuerdings reißen die fliegenden Händler immer öfter Pappkartons aus Pakistan oder Ostasien auf. „Die chinesische Qualität ist schlecht“, behauptet Favre, „aber viele Kunden schauen nur auf den Preis.“ Und da kann er kaum noch mithalten.
Wie Favre geht es vielen brasilianischen Unternehmern. Spottbillig sind die Angebote der ausländischen Konkurrenz geworden, seit der Real so hochgeschossen ist: Zum Dollar hat sich der Wert der Landeswährung seit 2002 verdoppelt.
Die „Dutch Disease“, die holländische Krankheit, hat Brasilien voll erwischt - so wie einst die Niederlande nach der Entdeckung großer Erdgasfelder. Durch den Boom bei den Rohstoffexporten wertet die heimische Währung rapide auf. Damit verteuern sich alle übrigen Exportgüter, Importe indes werden viel billiger.
Brasiliens Industrie leidet unter der „überteuertsten Währung der Welt“ (Goldman Sachs). Seit zwei Jahren stagniert die Produktion; für 2012 erwartet der Thinktank Fundação Getulio Vargas gar minus zwei Prozent.
Damit wird Brasilien immer mehr zur Rohstoffwirtschaft, auf Gedeih und Verderb abhängig von launischen Weltbörsen für Eisenerz, Soja oder Zucker. Zumal die Konjunktur lahmt: Nach 7,5 Prozent plus im Jahr 2010 schrumpfte die Wirtschaft 2011 zeitweise. Im Jahresverlauf legte sie noch 2,7 Prozent zu - das geringste Wachstum von ganz Südamerika.
Lange hat die Regierung das Problem verdrängt, nun schiebt sie die Schuld anderen zu. „Dieses Land lässt nicht zu, dass seine Industrie durch Währungsabwertung oder Handelskriege geschädigt wird“, wütet Präsidentin Dilma Rousseff. Und kündigt einen „Kreuzzug zur Verteidigung des brasilianischen Marktes“ gegen „unfairen und räuberischen Wettbewerb“ an.
Rousseffs Waffe heißt Protektionismus.
Sie hat die Zölle auf importierte Autos und Lkw erhöht. Öffentliche Aufträge, etwa für die Olympischen Spiele 2016 in Rio, sollen bevorzugt an heimische Firmen vergeben werden, selbst wenn deren Gebote 25 Prozent höher sind als die der ausländischen Konkurrenz.
Dazu werden die Steuern für die eigene Textil- und Möbelindustrie gesenkt.
Tiago Favres Begeisterung hält sich in Grenzen. „Die Probleme liegen tiefer“, sagt der Fabrikant. Im Wettbewerbsfähigkeitsranking des World Economic Forum (WEF) liegt Brasilien auf Platz 53 - hinter europäischen Sorgenkindern wie Portugal oder Ungarn. „Beängstigende Schwächen“ attestiert das WEF Brasilien bei der Verkehrsinfrastruktur. Überfüllte Häfen und Flughäfen, schlaglochübersäte Straßen, ein unterentwickeltes Eisenbahnnetz - all das in einem Land, das größer ist als die USA ohne Alaska.
Der starke Real legt die Schwächen des Standorts gnadenlos offen: geringe Produktivitäts- bei erheblichen Lohnsteigerungen, überteuerter Strom und überbordende Bürokratie. Beim Kriterium „Belastung durch staatliche Regulierung“ ist Brasilien Schlusslicht im WEF-Ranking.
Rousseff hingegen hat andere Prioritäten.
Sie drängt die Zentralbank, die Leitzinsen weiter zu senken, um einen Rest Wirtschaftswunder zu erhalten. Dabei ist die Inflation mit 6,5 Prozent so hoch wie seit 2004 nicht mehr.
Weil der Real trotz alldem nicht genug schwächelt, wertet Tiago Favre nun seinerseits auf. Hochwertigere, haltbarere Unterwäsche will er herstellen - und unter der Marke Dominio bewerben. Nur eines bleibt gleich: die Menge des verarbeiteten Materials. Mehr Stoff können seine Kundinnen gar nicht gebrauchen.
Russland: Geschäftsmodell gesucht
Die Wirtschaft schwankt im Takt der Rohstoffbörsen. Die Erneuerung bremst der Staat aus
Jurij Iwanenko könnte ein Beispiel für die Zukunft Russlands sein. Der 28-jährige Ingenieur hat gerade ein Planungsbüro aufgebaut, das Firmen hilft, energieeffizienter zu wirtschaften. Das Interesse ist groß, um Aufträge muss sich Iwanenko nicht sorgen. Allein die Behörden machen dem Moskauer das Leben schwer. Kaum war das Büro eröffnet, stand die Gewerbeaufsicht vor der Tür, es gebe Probleme mit dem Brandschutz. Auf Strom musste Iwanenko ein halbes Jahr lang warten. Als auch noch Beamte bauliche Mängel monierten, gab der Unternehmer klein bei - und zahlte Schmiergeld.
„Das widersprach all meinen Prinzipien“, sagt Iwanenko. „Aber ich wollte nicht im Dunkeln sitzen bleiben.“ Aus Wut ging er erstmals in seinem Leben auf die Straße - zu einer der Demonstrationen der Kremlgegner, die das Land aufwühlen. Bürokratie und Korruption lähmen seit Jahren das Geschäftsleben im Reich des Wladimir Putin. In der „Ease of Doing Business“- Rangliste der Weltbank, die misst, wie leicht Unternehmern das Gründen gemacht wird, belegt Russland Platz 120. Das ist mit Abstand der schlechteste Wert aller Staaten der Industrieländergruppe G8.
Lange konnte der Kreml die Missstände ignorieren. Bis zur ersten Welle der Wirtschafts- und Finanzkrise kam Russland auf sieben bis acht Prozent Wachstum, getrieben von Rohstoffen, den mit Abstand wichtigsten Exportgütern. Seither hat sich die Rate fast halbiert - obwohl der Ölpreis gerade wieder Höchststände erklimmt. Die Löhne, deren Anstieg bis 2008 die Entwicklung einer Mittelschicht beförderte, stagnieren nunmehr. Russland gilt als der große Verlierer der Finanzkrise, das Land braucht dringend ein neues Geschäftsmodell.
Putin hat das erkannt - und vor der Präsidentenwahl den radikalen Umbau der Wirtschaft versprochen. 25 Millionen Arbeitsplätze für hoch Qualifizierte sollen bis 2022 entstehen. Woher der Jobsegen kommen soll, bleibt indes unklar. Im Staatshaushalt jedenfalls klafft ein Milliardenloch.
Immerhin, einen Hoffnungsschimmer gibt es: In Kürze dürfte Russland den Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO endgültig abschließen, nach 18 Jahren Verhandlungsmarathon. Die Weltbank hofft dadurch auf bis zu drei Prozentpunkte zusätzliches Wachstum. Zugleich dürften der Fall der Zollschranken und die Öffnung des russischen Marktes wie ein Schock auf die heimische Industrie wirken. „Der WTO-Beitritt wird den russischen Maschinenbau durcheinanderwirbeln“, sagt Anders Aslund vom Washingtoner Peterson Institute voraus.
Auch die Autobauer dürften ohne Schutzmaßnahmen in kürzester Zeit von ausländischen Wettbewerbern weggefegt werden. Der Kreml hat daher eine Reihe von Übergangsfristen ausgehandelt und will nationale Unternehmen bei der Auftragsvergabe weiter bevorzugen.
Jurij Iwanenko jedenfalls hofft auf den baldigen Beitritt - schließlich bieten ihm die WTO-Regeln eine Handhabe gegen behördliche Schikanen. Bis es so weit ist, will er weiter demonstrieren wie so viele Geschäftsleute seiner Generation.
Vielleicht ist Iwanenko ja doch ein Beispiel für die Zukunft Russlands. Dann allerdings ein trauriges.
Indien: Die asiatische Schuldenkrise
Dem Boom geht die Kraft aus, die Regierung ist unfähig, ihn mit Reformen zu reanimieren
Am Ende half das Betteln nichts. Eine Stunde lang beackerten Spitzenbeamte des indischen Finanzministeriums Takahira Ogawa, schwärmten ihm von angeblich glänzenden Wachstumsperspektiven vor und versprachen dem Gast eine Eindämmung ihrer Haushalts- und Außenhandelsdefizite.
Doch der Standard & Poor’s- Analyst lächelte nur höflich. Und verkündete Ende April sein Urteil. Er senkte das Rating auf „BBB-“ herab, Ausblick: „negativ“. Damit liegt Indiens Kreditwürdigkeit nur noch eine Stufe über Ramschstatus.
Tausende Kilometer östlich von der Euro-Zone, unbemerkt vom Westen, dräut eine neue Schuldenkrise. Nach Griechenland und Spanien nehmen sich die Ratingagenturen nun Indien vor. Ein Schock für die Milliardennation. Standard & Poor’s hatte kaum gesprochen, da rief Finanzminister Pranab Mukherjee die Bürger öffentlich auf, bloß nicht panisch zu werden. Die Regierung werde die Lage in den Griff bekommen. Bislang macht sie nicht den Eindruck.
Im Haushalt des Fiskaljahrs 2011/12 klaffte ein Loch von erschreckenden 5,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für 2012/13 hat sich das Kabinett des greisen Premiers Manmohan Singh ein Minus von 5,1 Prozent vorgenommen. „Lasst uns für reichlich Regenfall und niedrige Ölpreise beten“, zitierten Medien nach dem Budgetbeschluss einen Minister.
Denn je teurer importierte Lebensmittel und Energie werden, desto größer wird das Minus in der Kasse. Schließlich hält der Staat die Preise für Nahrung, Benzin und Dünger mit Zuschüssen künstlich niedrig. 2011 kostete das bereits mehr als 45 Mrd. Dollar an Steuergeldern. Angesichts der jüngsten Öl-Hausse dürften die Subventionen weiter anschwellen - und damit auch die Schuldenquote von rund 70 Prozent.
Ein Ende der Subventionitis ist nicht in Sicht. Nach einigen großen Korruptionsskandalen habe „die Regierung ihr Momentum verloren“, kritisieren die Analysten der Ratingagentur Moody’s. Sie sei unfähig, „entschlossene Reformen durchzudrücken, um die nächste Wachstumswelle auszulösen“. Und dem alten Boom geht die Kraft aus. Nach jahrelangen Plusraten von acht bis zehn Prozent wuchs die Wirtschaft 2011 lediglich um 6,9 Prozent; zurzeit sind es noch 6,1 Prozent.
Die Dynamik ist raus. Katastrophal, denn das Pro-Kopf-Einkommen liegt gerade mal bei 1500 Dollar. Wie groß die Not ist, zeigt die jüngste Zinssenkung der Reserve Bank of India.
Der Internationale Währungsfonds hat vor einem solchen Zinsschritt gewarnt, denn die Inflation ist hoch, die indische Rupie verliert an Wert. Doch die Unternehmen fordern noch billigeres Geld. „Für Wachstum brauchen wir niedrige Zinsen“, verlangt Adi Godrej, Präsident des Verbands CII. Die Industrie, die 2011 nur noch um 3,5 Prozent zulegte, lechzt nach Reformen.
Im „Ease of Doing Business“-Report der Weltbank belegt Indien Platz 132 von 183 Staaten, vor allem wegen der übermächtigen Bürokratie. Hinzu kommen überaltete Verkehrswege, unvorhergesehene Stromausfälle - und mangelhafte Rechtssicherheit. So hat das Kabinett kürzlich die lang beschlossene Öffnung des Einzelhandels für ausländische Wettbewerber einfach aufgeschoben.
Für Moody’s sind solche Manöver blanker Populismus. Die Regierung sei die „größte einzelne Belastung“ für die Zukunft der Wirtschaft - und Premier Singh „ein alternder Technokrat“. Auch sie sieht Indien unmittelbar vor Ramschstatus.
China: Ein Billiglohnland wird teuer
Steigende Personalkosten und Steuern vertreiben die ersten Industriezweige ins Ausland
„Wie, kein heißes Wasser im Arbeiterwohnheim?“, empört sich Frau Wang. Die Endzwanzigerin schaut sich am Stand einer kleinen Taschenfabrik nach Arbeit um. „Momentan verdiene ich 3000 Yuan im Monat. Ich will mehr, aber vor allem eine bessere Wohnsituation“, sagt Wang. Sie möchte mit ein paar Freundinnen zusammenwohnen, um Miete zu sparen.
Aber das kann ihr die Taschenfabrik nicht bieten, die Zimmer sind zu klein. Die Schicht ist um 22 Uhr vorbei, wie sieht es mit der Verkehrsanbindung aus? „Im Dunkeln will ich nicht mehr weit laufen.“ Arbeiterinnen wie Wang haben neuerdings Ansprüche, weil sie sich die leisten können. Am Marktplatz des Industrieviertels von Kanton reiht sich ein Fabrikstand an den anderen, alle buhlen auf roten Schildern um neue Mitarbeiter.
Hier im Perlflussdelta, wo vor 30 Jahren einst der große Wirtschaftsboom begann, wird klar: China ist längst nicht mehr das Land unerschöpflicher Arbeitskraft. Und: Der Standort wird teuer. Auf einer Konferenz in Peking schockierte ein BMW-Manager kürzlich das Publikum mit dem Satz, ein BMW lasse sich heute in Deutschland günstiger bauen als in China.
Land, Steuern, Umwelt- und Sicherheitsauflagen - die Kosten schießen hoch, die Aufwertung des Renminbi verteuert die Exporte. Die größte Sorge der Betriebe sind die Löhne. Im Perlflussdelta sind sie nach Berechnungen der Investmentbank Standard Chartered allein in den ersten beiden Monaten 2012 um zehn Prozent gestiegen. Im benachbarten Shenzhen erhöhte der Apple-Zulieferer Foxconn die Gehälter gar um 16 bis 25 Prozent.
Makroökonomisch ist das durchaus sinnvoll - die Regierung in Peking weiß, dass die extreme Exportabhängigkeit auf Dauer ungesund ist und die Kaufkraft der eigenen Bevölkerung steigen muss. Doch noch hält sich die Ausgabenfreude der Mittelschicht in Grenzen. Der Anteil des Konsums am Inlandsprodukt ist seit 2000 von 45 Prozent auf unter 35 Prozent gefallen.
Schuld daran ist unter anderem die hohe Sparquote der schlecht gegen Krankheit und Alter versicherten Chinesen. Steigende Lohnkosten und sinkende Aufträge aus dem kriselnden Westen - ein gefährlicher Cocktail für Chinas Exportindustrie. In den beiden ersten Monaten 2012 sanken die Profite größerer Unternehmen um fünf Prozent. Laut Umfrage eines Hongkonger Verbands für kleine und mittlere Unternehmen planen zwei von fünf Mitgliedern, ihre Betriebe im Perlflussdelta dichtzumachen. Wer etwa in der Textilbranche ein neues Geschäft aufzieht, siedelt die Fabriken von vornherein an Billiglohnstandorten wie Bangladesch oder Kambodscha an.
Für anspruchsvollere Sektoren wie den Maschinenbau ist China hingegen hochattraktiv. Die gut funktionierenden Industriecluster rund um die chinesischen Küstenmetropolen machen die höheren Löhne mehr als wett. „Ich muss einen ganzen Produktionsfluss darstellen können. Dafür benötige ich die Materialien, das Know-how, Fachkräfte und gute Transportmöglichkeiten“, sagt Jan Nöther, Chef der Deutschen Außenhandelskammer in Schanghai. Bei solchen Lieferketten ist China noch unschlagbar.